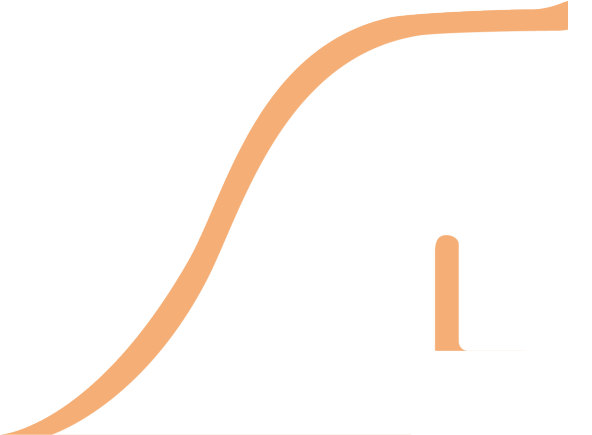Equines Asthma: Wenn die Luft dünn wird - nicht nur im Herbst
© Shutterstock
Bar ohne Namen
Entschlossen verweigert sich Savage, der Bar einen Namen zu geben. Stattdessen sind drei klassische Design-Symbole das Logo der Trinkstätte in Dalston: ein gelbes Quadrat, ein rotes Viereck, ein blauer Kreis. Am meisten wurmt den sympathischen Franzosen dabei, dass es kein Gelbes-Dreieck-Emoji gibt. Das erschwert auf komische Weise die Kommunikation. Der Instagram Account lautet: a_bar_with_shapes-for_a_name und anderenorts tauchen die Begriffe ‘Savage Bar’ oder eben ‚Bauhaus Bar‘ auf.
Für den BCB bringt Savage nun sein Barkonzept mit und mixt für uns mit Unterstützung von Russian Standard Vodka an der perfekten Bar dazu.
Die schlechte Nachricht zuerst: Equines Asthma ist nicht nur eine der häufigsten Pferdekrankheiten, sie ist zudem in der Regel hausgemacht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Wir haben die (Lungen-)Gesundheit unserer Pferde in der Hand!
Fragt man Tierärztin Dr. Franziska Aumer, ob man bei Equinem Asthma von einer Zivilisationskrankheit sprechen kann, ist ihre Antwort eindeutig: „Ein ganz klares Ja! Ein Wildpferd mag sich einen akuten Infekt zuziehen können – wobei der Infektionsdruck in einem Pensionsbetrieb ungleich höher ist –, aber eine chronische Erkrankung der Atemwege wird man bei ihnen nicht finden.“ Genau das ist Equines Asthma: eine chronische Erkrankung der Atemwege. Also kein akutes Krankheitsgeschehen wie bei einer viralen Infektion, das nach Ausheilung verschwindet, sondern ein dauerhaftes Problem, das mal schwächer, mal stärker zu Tage treten kann. Die Spannbreite ist groß. Manche Patienten haben kaum oder auch gar keine Symptome. Bei anderen ist es so schlimm, dass sie eingeschläfert werden müssen. Die Statistik sagt, unter vier Pferden in Deutschland ist eines, das unter einer Atemwegserkrankung leidet. 11 bis 17 Prozent von ihnen sind chronisch krank. Auslöser Nummer eins: schlechte Haltung – Staub, miefige Luft im Stall mit wenig Sauerstoff, womöglich aber hoher Luftfeuchtigkeit, dazu den Ausgasungen durch die Zersetzung von Fäkalien (Ammoniak, Schwefelwasserstoff) sowie Allergene im Futter (Pilzsporen). All das macht die empfindlichen Atemwege des Pferdes krank. Auch Pollen und damit einhergehende Allergien spielen eine Rolle beim Equinen Asthma. Eine Studie mit Lippizaner und Warmblütern konnte außerdem belegen, was bei Menschen schon lange bekannt ist: Das Risiko einer Erkrankung steigt, wenn eines oder gar beide Elternteile belastet sind. Es gibt also auch eine erbliche Komponente. Zudem wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Häufung an Atemwegserkrankungen und dem Klimawandel. Direkt bewiesen ist das nicht. Fakt ist jedoch: Equine Asthmatiker reagieren auf Staub, Pollen und/oder Schimmelpilze bzw. manche auch auf schwülwarmes Klima. All diese Faktoren sind wetterabhängig. Und auf das Wetter hat der Klimawandel Einfluss.
Haltung und Fütterung optimieren
Was wir als Menschen für unsere Pferde tun können, egal ob gesund oder bereits erkrankt, – und das könne man gar nicht oft genug betonen, sagt Dr. Franziska Aumer – ist das Optimieren der Haltung: so naturnah wie möglich, sprich im Offenstall, zumindest aber in einer Box mit Außenfenster in einem gut belüfteten Stall mit passendem Hygiene- und Fütterungsmanagement.
Vor allem letzteres ist allerdings häufig ein Problem und dann auch noch eines, auf das man als Pferdebesitzer wenig Einfluss hat. Die Heuqualität lässt in vielen Ställen zu wünschen übrig. Da bleibt nur das Wässern des Heus (zehn Minuten ganz eintauchen), um Staub zu binden. Allerdings werden dabei auch Nährstoffe ausgewaschen. Im Falle von Zucker ist das für manche Pferde ein Vor-, für andere aber auch ein Nachteil.
Eine andere Möglichkeit ist das Bedampfen. In speziellen Heubedampfern, in denen ganze Ballen Platz finden, wird das Heu mit heißem Wasserdampf unter Temperaturen bis zu 100 Grad Celsius behandelt. Das bindet ebenfalls Staub und Pilzsporen und tötet zudem schädliche Mikroorganismen ab. Der Keimgehalt des Heus sinkt. Allerdings ist bedampftes Heu weniger gut verdaulich. Es kann zu einem Proteinmangel kommen, was besonders für Pferde in der Zucht, im Wachstum oder im Leistungssport von Nachteil ist. Aber hier kann durch Zusatzfutter (in Absprache mit Tierarzt und/oder Futterexperten) für Ersatz gesorgt werden.
Heulage staubt ebenfalls weniger als trockenes Heu. Doch egal, was gefüttert wird, gilt: Je hochwertiger das Heu, desto gesünder. Darauf hat aber auch der Landwirt nur bedingt Einfluss. Zwar spielt die Erntetechnik eine Rolle. Doch der wichtigste Faktor ist das Wetter. In Jahren, in denen kaum Regen fällt, ist die Ausbeute nicht nur mager, sondern auch noch staubig. „Dieses Jahr hingegen hatten wir viel Regen. Es hat immer wieder ins Heu reingeregnet. Das bedeutet mehr Pilzsporen“, erklärt Dr. Aumer. „Hinzu kommt, dass die Luftfeuchtigkeit hoch war und zum Teil auch bereits gelagertes Heu zu schimmeln beginnt.“ Letzteres kann noch so gründlich gewaschen werden, es gehört auf den Misthaufen und nicht in eine Pferdebox!
Was Pferdemenschen auch bedenken müssen: Selbst, wenn der eigene Vierbeiner optimiertes Heu bekommt – seine Boxennachbarn bekommen womöglich weiter das gewohnte Futter, womit die Situation für den Patienten in der Regel immer noch nicht zufriedenstellend gelöst ist. Das gleiche gilt für die Einstreu. Man muss als Verantwortlicher für einen Asthma-Patienten also buchstäblich über den eigenen Tellerrand hinausdenken, um zum Ziel zu kommen – und unbedingt den Stallbesitzer und das Personal mit einbeziehen, denn die Stallarbeiten (Heu verteilen, aufschütteln, einstreuen, fegen) dürfen nur verrichtet werden, wenn die Pferde nicht im Stall sind. Für alle Beteiligten gilt: Es braucht etwas Geduld. Bis sich die positiven Effekte der Haltungsumstellung bemerkbar machen, kann ein gutes Vierteljahr ins Land ziehen.
Training ist Trumpf
Bei entsprechendem Management können auch chronisch kranke Pferde nahezu symptomfrei leben. Neben der Haltungsoptimierung spiele da auch die Arbeit des Pferdes eine essenzielle Rolle, weiß Tierärztin Dr. Aumer, die außerdem auch Trainerin A Reiten ist. Bei signifikantem Anstieg der Atemfrequenz werde die Lunge trainiert und „gereinigt“. Normal sind bei einem ausgewachsenen Pferd in Ruhe 8 bis 16 Atemzüge pro Minute (von denen jeder einzelne ca. fünf Liter Luft bewegt). Bei mittlerer Anstrengung holt das Pferd 30 bis 70 mal in der Minute Luft. Bei maximaler Belastung kann die Atemfrequenz auf bis zu 150 Züge pro Minute ansteigen. Das sind allerdings Werte, die man eher aus dem Rennsport kennt. Das muss es nicht sein. Aber „laufen ohne zu schnaufen“ sei trotzdem das falsche Motto, denn: „Bei normaler Atmung benutzt das Pferd nur einen Teil seiner Lunge“, verdeutlicht Dr. Aumer. „Das ist wie in einem Haus, in dem es ein unbenutztes Zimmer gibt. Das muss von Zeit zu Zeit gelüftet werden. Das geschieht in der Pferdelunge, wenn es forciert atmet.“ Ins Pusten sollten die Pferde also regelmäßig kommen, auch weil Bewegung den Abtransport des Schleims in den Atemwegen anregt. Das ist gesund, weil mit dem Schleim auch etwaige Fremdstoffe ausgespült werden. Quasi eine Lungenreinigung. Positiver Nebeneffekt: „Neben der Lunge wird auch das Herz-Kreislaufsystem trainiert“, erinnert Dr. Aumer. „Bei einer akuten Erkrankung haben diese Pferde mehr Widerstandskraft als untrainierte Stallkollegen.“ Ihre Empfehlung lautet daher: „Ein gesundes Pferd im mittleren Trainingszustand sollte dreimal pro Woche ca. zwei Kilometer flott galoppieren.“ Allerdings weist Aumer auch darauf hin, dass man hier keine pauschalen Angaben machen kann. „Es gibt dazu keine offiziellen Daten und es ist sehr individuell, was für das einzelne Pferd anstrengend ist. Für ein Vielseitigkeitspferd sind zwei Kilometer nichts. Für ein Pferd, das ansonsten hauptsächlich im Gelände gebummelt wird, ist das richtig viel. Wichtig ist, dass das Pferd ca. dreimal pro Woche wirklich forciert atmet.“
Und was macht man jetzt im Winter, wenn die Tage kürzer werden und man auf die Reithalle angewiesen ist? Hier ist zum einen der Stallbesitzer gefragt. Er muss rechtzeitig Magnesiumchlorid oder ähnliches unter den Reithallenboden mischen, damit dieser nicht einfriert. Außerdem ist darauf zu achten, dass der Boden auch im Winter wann immer möglich bewässert wird, um den Staub zu binden. Idealerweise macht man das abends, wenn der Betrieb abgeebbt ist und man den Boden auch glätten kann. Ansonsten gilt das gleiche wie immer: so viel frische Luft, wie nur irgend möglich!
Empfindliches Naturwunder
Um zu verstehen, wieso die Atemwege des Pferdes so anfällig sind, lohnt sich ein Blick ins Innere des Pferdes. Der gesamte Respirationsapparat ist wie ein liegender Baum im Körper positioniert. Nüstern und Rachenraum sind die Wurzeln, die Luftröhre ist der Stamm, die Bronchien die Äste, die sich immer feiner verzweigen, bis sie schließlich weniger Durchmesser als ein Menschenhaar haben. Dies sind die Bronchiolen an deren Ende die Lungenbläschen, die Alveolen, sitzen. Sie haben gerade mal einen Durchmesser von 0,3 Millimeter und werden von einem Netz feinster Blutgefäße umhüllt, den Kapillaren. Die Alveolen sind für den Gasaustausch zuständig, also dafür, dass Sauerstoff ins Blut gelangt und CO2 aus dem Blutkreislauf zurück in die Lunge, um dann abgeatmet werden zu können. Das Pferd verfügt über ca. 750 Millionen dieser kleinen Naturwunder. Würde man sie ausbreiten, würden sie ein ganzes Fußballfeld abdecken und schon im Normalzustand bewegen sie rund 100.000 Liter Luft pro Tag! Ein ausgeklügeltes System! Allerdings auch ein störanfälliges. Doch auch hier hat die Natur vorgesorgt: Bis zu einem gewissen Umfang kann der Körper sich Reizstoffen wie Staub, Schleim und Bakterien selbst entledigen.
Der Hustenreflex ist eine Methode, die er nutzt, um Fremdstoffe loszuwerden. Husten ist also erst einmal keine Erkrankung als solche, sondern nur ein Symptom, mit dessen Hilfe größere Schmutzpartikel und Schleimbrocken aus der Luftröhre entfernt werden. Sind die Fremdstoffe tiefer eingedrungen, schützt ein körpereigenes Förderband die Bronchien. An Bronchien und Bronchiolen setzen kleine Flimmerhärchen an, die sogenannten Zilien. Sie können sich bewegen und sind mit einer feinen Schleimschicht überzogen. Auf diese Weise leiten sie Schadstoffe wie Viren, Bakterien und Staubpartikel aus den Bronchien in den Rachen, wo sie unschädlich gemacht werden. Und auch die kleinsten Glieder der Kette, die Alveolen, haben ihr eigenes Abwehrsystem: eine Schleimschicht sowie Makrophagen, spezielle Fresszellen, an ihrer Oberfläche, die die Lungenbläschen sowohl schützen als auch reinigen. Problematisch wird es, wenn dieses ausgeklügelte System gestört wird, etwa infolge eines Infekts.
Wehret den Anfängen
Akute Infektionen werden meist durch Viren ausgelöst. Typische Symptome: Fieber (über 38°), kein bzw. weniger Appetit, Apathie, allgemeine Mattigkeit, Husten, Atemnot, weißlich-wässriger Nasenausfluss, geschwollene Lymphknoten an den Ganaschen. Was wir nicht sehen können: Im Pferdekörper schwellen die Schleimhäute aufgrund der Entzündung in den Atemwegen an. Es kann nicht mehr so viel Luft ein- und ausströmen, das Pferd hat Atemnot. Kommt dann noch ein Bronchospasmus hinzu, also ein Verkrampfen der Atemwege, wird das Atmen noch schwieriger. Im nächsten Schritt bilden die Bronchien zu viel und zu zähen Schleim, den die Flimmerhärchen nicht abtransportieren können. Sie brechen ab. Der Schleim verbleibt in den Atemwegen – noch ein Faktor, der dem Pferd das Atmen erschwert. Gleichzeitig finden Bakterien auf dem krankhaften Schleim perfekte Bedingungen, um sich zu vermehren. Darum kommt es häufig zu bakteriellen Sekundärinfektionen.
Chronische Erkrankung
Chronisch bedeutet nicht zwangsläufig unheilbar, zumindest aber langwieriger. Eine Atemwegserkrankung wird in der Regel aus zwei Gründen chronisch (dann spricht man von Equinem Asthma): Zum einen, weil ein akuter Infekt verschleppt wurde und die entzündeten Atemwege beginnen, überempfindlich auf Reize (z. B. mit Pilzsporen belasteten Staub) zu reagieren. Das Pferd hat eine Allergie gegen diese Reize entwickelt, die überschießende Immunantwort führt zur dauerhaften Verkrampfung der Bronchien. Zum anderen entwickelt sich Equines Asthma, wenn das Pferd über einen längeren Zeitraum schlechten Haltungsbedingungen ausgesetzt ist. Auch dann kommt es zu der Kettenreaktion Überempfindlichkeit – Verkrampfung – Atemnot.
Behandlungsmöglichkeiten
Die wichtigste Therapie bei Equinem Asthma ist die Optimierung der Haltung: so viel frische Luft, wie es nur geht, am besten Umstellung in einen Offenstall. Das Minimum ist ein Außenfenster. Reagiert das Pferd auf Pollen, muss es eventuell ebenfalls den Stall wechseln, zumindest aber auf eine Weide, auf der die Allergieauslöser nicht fliegen. Das Heu sollte gewässert bzw. noch besser bedampft, Stroh gegen staubfreie Materialien ausgewechselt werden.
Der Tierarzt verordnet Medikamente, meist einen Schleimlöser, der das zähe Sekret verflüssigen soll, so dass es leichter abgehustet werden kann, sowie ein Präparat, das den Bronchospasmus löst. Dadurch werden die Bronchien erweitert, das Pferd kann besser atmen, die Sauerstoffversorgung verbessert sich und schon das bekämpft die akute Entzündung. Hinzu kommt ein Kortisonpräparat, das ebenfalls die Verkrampfungen der Atemwege löst, die Entzündung bekämpft und antiallergisch wirkt. „Manche Equine Asthmatiker bekommen Probleme bei Pollenflug, andere bei Trockenheit – zugrunde liegt den Problemen dann ein akutes Entzündungsgeschehen, das man am besten sofort mit Kortison bekämpft“, sagt Dr. Franziska Aumer. „Mit allem anderen verschwendet man nur Zeit.“ Das Ziel müsse es aber sein, mit so wenig Arzneien wie möglich auszukommen. „Bei richtigem Management brauchen die meisten chronisch kranken Pferde dann keine Medikamente“, so die Tierärztin. Umgekehrt gilt: Wenn es über einen längeren Zeitraum nicht ohne Behandlung geht, muss weiter an der Haltung getüftelt werden. Da hilft zum Beispiel auch ein Hustentagebuch, in dem man festhält, wann die Pferde besonders viel husten, wo sie sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten haben, welche externen Bedingungen herrschten usw.
Wenn keines der o. g. Medikamente den gewünschten Effekt hat, kann eine Hyperinfusionstherapie, umgangssprachlich als Lungenspülung bekannt, probiert werden. Dies ist allerdings das letzte Mittel der Wahl und nicht zu empfehlen, wenn die Pferde neben der Lungenproblematik auch eine Herzschwäche haben. Anders als der Name vermuten lässt, wird bei der Behandlung nicht etwa Flüssigkeit in die Lunge eingeleitet, sondern das Pferd bekommt die Flüssigkeit intravenös sowie über eine Sonde in den Magen. Der Körper wird so mit Flüssigkeit „geflutet“, dass er auch die Schleimhäute in den Atemwegen nutzt, um diese loszuwerden. So sollen die Atemwege gereinigt, der Schleim gelöst und die Flimmerhärchen reaktiviert werden. In der Praxis finde diese Methode allerdings kaum noch Anwendung, sagt Dr. Franziska Aumer. Sie helfe nur bei extremer Verschleimung - und auch nur kurzfristig.
Inhalieren?
Eltern schwören drauf, Kinder hassen es: inhalieren. Unbestritten ist allerdings, dass es hilft. Gilt das auch für Pferde? Jein, meint Dr. Franziska Aumer. „Bei verkrampften Bronchien hilft Inhalieren nur mit Kochsalzlösung nicht. Dann muss es schon Kortison oder ein Bronchodilator (Medikament, das die Bronchien erweitert, Anm. d. Red.) sein. Aber wenn das Pferd sehr verschleimt ist, kann das Inhalieren mit Kochsalz den Schleim verflüssigen, so dass er leichter abgehustet werden kann.“ Bedenken müsse man allerdings, dass Schleim und Bronchospasmus ja nur Symptome seien. „Die Ursache für beides ist eine Entzündung. Der Grund für die Entzündung sind Fehler in der Haltung. Da kann ich also noch so viel inhalieren lassen, ich packe das Übel nicht an der Wurzel. Es geht darum, die Entzündung zu verhindern, indem ich den Grund dafür beseitige. Wenn mein Kind eine Katzenhaarallergie hat, halte ich es ja auch von Katzen fern und lasse nicht die Katze im Zimmer und das Kind inhalieren.“
Als zusätzliche Maßnahme, um dem Pferd bei einem akuten Krankheitsschub Linderung zu verschaffen, sei gegen Inhalieren jedoch nichts einzuwenden, meint Dr. Aumer. „Wichtig ist dann, dass man einen hygienisch einwandfreien Vernebler benutzt. Nur dann sind die Tropfen klein genug, um auch die tiefen Atemwege zu erreichen.“ Schon Kochsalzlösung kann den Schleim lösen. Man kann die Pferde aber auch Medikamente einatmen lassen, auch Kortison. Zu bedenken sei dann aber, dass ein Großteil davon nicht in der Lunge ankommt, sondern abgeschluckt wird. So lasse sich die Dosis schwer berechnen. Abzuraten sei davon, die Pferde ätherische Öle inhalieren zu lassen, sagt Aumer. „Sie können die Flimmerhärchen zerstören. Zudem eignen sie sich nicht für die Verneblung, weil sie sich nicht so klein zerstäuben lassen.“ Die Wirksamkeit von Kräutern wie z. B. Thymian etc. ist wissenschaftlich noch nicht belegt. Sie schaden allerdings auch nicht. Da hilft ausprobieren. Manche Pferde mögen entsprechende Mischungen zudem ausgesprochen gern. Ein Vernebler ist nicht ganz günstig, aber die Anschaffung lohnt sich. Alternativ gibt es inzwischen auch Therapeuten, die mobile Solekammern anbieten, zum Beispiel in umgebauten Pferdeanhängern. Das sei prinzipiell eine gute Sache, allerdings müsse man auch hier auf die Hygiene achten. Nach jeder Benutzung muss so ein Raum desinfiziert werden, damit ein akut infiziertes Pferd kein anderes anstecken kann.
Und was ist mit Asthmasprays wie es sie für Menschen gibt? Bei Bedarf hat der Tierarzt die Möglichkeit, Medikamente fürs Pferd „umzuwidmen“. Dann kann man mit einem sogenannten Spacer, sozusagen einem Adapter fürs Pferd, auch Asthmasprays für Menschen nutzen.
Dämpfigkeit – wenn nichts mehr geht
Aus Equinem Asthma kann sich Dämpfigkeit entwickeln. Das passiert, wenn die Übergänge aus den Bronchiolen in die Alveolen durch Schleim und/oder Schwellungen so verengt sind, dass die Atemluft zwar noch in die Alveolen ein-, aber nicht mehr vollständig ausströmen kann. Das Ergebnis: Die Lungenbläschen überblähen und platzen schließlich. Hier ist nichts mehr zu machen. Das Pferd büßt an Atemkapazität ein. Je mehr Gewebe betroffen ist, desto schlimmer ist es. Der Begriff Dämpfigkeit rührt von dem Versuch des Pferdes her, mithilfe der Bauchmuskulatur das Kohlendioxid aus der Lunge abzuatmen. Es presst den Bauch zusammen, man sieht die sogenannte Dampfrinne. In besonders schlimmen Fällen kann das eine tödliche Diagnose sein. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig vorzubeugen und das Pferd möglichst von Anfang an so unterzubringen, dass es gar nicht erst zu einer haltungsbedingten chronischen Krankheit kommt.
Die Expertin:
Dr. Franziska Aumer hat Tiermedizin an der FU Berlin studiert und als Tierärztin an den Unikliniken Wien und München gearbeitet. Später war sie Gestütstierärztin auf dem Gestüt Birkhof und ist heute als Tierärztliche Fachberaterin Pferd bei Boehringer-Ingelheim Vetmedica GmbH beschäftigt. Sie ist selbst Reiterin und hat die Qualifikation als Trainerin A Reiten.